20. November 2025
Info
Emotionsforschung, Teil 2: Die „Angeborenen“
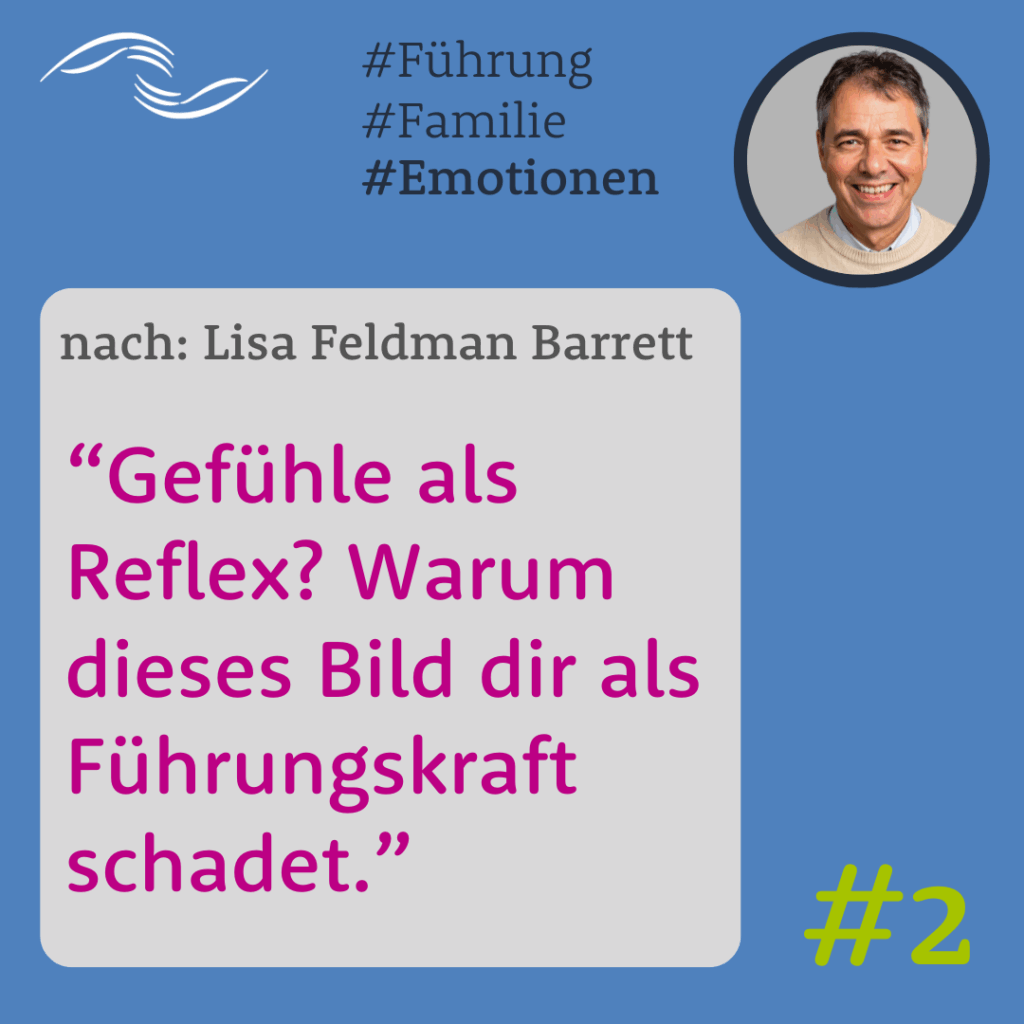
Warum sich Gefühle wie Naturgewalten anfühlen
Schon mal erlebt: Du kommst nach einer kurzen Nacht ins Büro, das Kind hat morgens zum dritten Mal in dieser Woche wegen der Lieblingshose geweint, und im Teammeeting stellt jemand deine Entscheidung öffentlich infrage. Noch während du versuchst, professionell zu bleiben, merkst du, wie dir innerlich die Sicherungen durchknallen. Es fühlt sich an, als ob etwas in dir losgeht, das du nicht bestellt hast. Wie eine Welle, die dich einfach überrollt. Genau dieses Erleben ist der Grund, warum die klassische Sicht auf Emotionen so überzeugend wirkt.
Seit der Antike erzählt unsere Kultur im Grunde die gleiche Geschichte: Emotionen sind angeborene Programme, sie werden von der Außenwelt ausgelöst, sie sind überall gleich und sie müssen von der Vernunft im Zaum gehalten werden. Von Platon über Darwin bis Freud, von Hollywoodfilmen bis hin zu vielen Führungsratgebern.
In diesem zweiten Teil der Serie, basierend auf dem Buch „Wie Gefühle entstehen“ von Lisa Feldman Barrett, schauen wir uns diese alte Geschichte genauer an. Nicht im Sinne von „alles Quatsch“, sondern eher wie eine Software, die lange gut funktioniert hat, aber für dein heutiges Leben als junge Führungskraft mit Familie Nebenwirkungen hat.
Was die klassische Sicht über Gefühle behauptet
Die klassische Sicht von Emotionen lässt sich grob in drei Kernideen zusammenfassen. Wenn du sie einmal vor Augen hast, erkennst du sie überall: in Filmen, in Alltagsreden, in Führungstrainings und auch in deinem eigenen inneren Dialog.
1. Universelle Auslöser: „Der hat mich wütend gemacht“
Nach der klassischen Sicht laufen Gefühle etwa so ab:
Etwas passiert, dein Gehirn drückt auf einen inneren Knopf und zack, die passende Emotion springt an.
Ein Beispiel aus deinem Alltag:
- Im Büro: Eine E-Mail deines Chefs mit dem Betreff „Dringend, da müssen wir reden“ und dein Körper geht in Alarmbereitschaft.
- Zuhause: Dein Kind wirft beim Abendessen den Teller runter und du spürst, wie sich die Wut staut.
Die Botschaften dahinter lauten: Das Außen löst in dir etwas aus. Der Kollege macht dich wütend. Die Situation macht dich hilflos. Das Verhalten deines Kindes macht dich traurig.
In diesem Modell bist du deinen Gefühlen ausgeliefert. Emotionen passieren dir, du bist eher Reaktionsfläche als Gestalter:in.
2. Der emotionale Fingerabdruck: „Man sieht doch, wie du dich fühlst“
Die zweite große Annahme: Jede Basisemotion hat einen eindeutigen, biologischen Fingerabdruck.
Nach dieser Logik müsste es geben:
- ein typisches Wut-Gesicht
- einen typischen Angst-Körper
- ein typisches Trauer-Muster im Gehirn
Wenn das stimmen würde, könnte man an Puls, Blutdruck oder Gesichtsausdruck ablesen, was du fühlst. Viele Trainings, Tests und Tools bauen genau auf diesem Bild auf.
In der Führungswelt sieht das zum Beispiel so aus:
- Assessment-Center, in denen „Körpersprache“ angeblich klar verrät, ob jemand souverän, ängstlich oder aggressiv ist
- Ratgeber, die versprechen, du könntest „Emotionen lesen“ wie Schlagzeilen
- Feedbacks wie „Du siehst schon wieder so genervt aus“, als ob dein Gesicht die objektive Wahrheit abbildet
Auch im Familienalltag kennst du das: „Der Blick deines Kindes sagt alles.“ „Man sieht dir doch an, dass du wütend bist.“
Die Idee dahinter: Gefühle sind innen fest verdrahtet, außen klar erkennbar und überall auf der Welt identisch.
3. Der innere Kampf: „Bauch gegen Kopf“
Die dritte Säule dieser alten Theorie ist das Bild vom permanenten Krieg zwischen Emotion und Vernunft.
Emotion wird darin oft so beschrieben:
- wild
- animalisch
- unzuverlässig
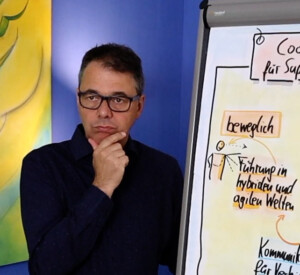
Robert bei der Arbeit: Emotionen verstehen, um als Führungskraft mit Familie klarer zu führen.
Vernunft dagegen gilt als:
- sachlich
- überlegen
- kontrollierend
Auch in der Sprache taucht dieses Bild ständig auf: „Reiß dich zusammen.“ „Lass die Emotion jetzt mal raus aus dem Raum.“ „Denk rational, nicht emotional.“
Als junge Führungskraft mit Familie landest du dadurch schnell in einem inneren Gerichtssaal:
- Im Büro klagt die „Vernunft“ deine Gefühle an, wenn du genervt oder müde bist.
- Zuhause klagt dein „Eltern-Ich“ dich an, wenn du aus der Haut fährst, obwohl du es besser weißt.
Die versteckte Botschaft: Du bist dann gut, wenn du deine Gefühle möglichst gut im Griff hast. Oder sie im Zweifel wegdrückst.
Warum diese alte Geschichte sich so gut anfühlt und dir trotzdem schadet
Auf den ersten Blick wirkt die klassische Sicht sehr ordentlich. Sie sortiert die chaotische Welt der Gefühle in klare Schubladen. Das ist angenehm. Vor allem, wenn du zwischen Kitaeingewöhnung, Budgetplanung, Hustenwelle und Zielvereinbarung unterwegs bist.
1. Sie nimmt dir Verantwortung, aber auch Gestaltungsmacht
Wenn du glaubst: „Die Situation hat mich wütend gemacht“, dann bist du in dem Moment entlastet. Du kannst nicht anders. Es ist die Natur.
Die Kehrseite: Du kommst schwer aus der Opferrolle heraus.
- Das Team ist schuld, dass du gereizt reagierst.
- Die Kinder sind schuld, dass du dauernd explodierst.
- Die Organisation ist schuld, dass du innerlich zumachst.
Wenn Gefühle aber nur Reflexe sind, lohnt es sich nicht, genauer hinzuschauen. Dann übersiehst du wichtige Informationen aus deinem Körper und Kontext, die dir helfen könnten, anders zu reagieren.
2. Sie verführt zu einfachen Erklärungen für komplexe Menschen
Die Idee vom emotionalen Fingerabdruck lädt zu Etiketten ein.
- „Der Kollege ist halt cholerisch.“
- „Die Mitarbeiterin ist eben zu sensibel.“
- „Mein Kind ist einfach eine Dramaqueen.“
Solche Etiketten machen den Alltag kurz überschaubarer, sie verengen aber deinen Blick. Statt zu fragen „Was geht in diesem Menschen gerade vor?“ reagierst du auf das Label, das dein Gehirn schnell drüber klebt.
Im Führungsalltag kann das bedeuten:
- Du unterschätzt stille Teammitglieder, weil ihr Stress nicht sichtbar wird.
- Du verkennst, wie sehr jemand belastet ist, weil das Gesicht ruhig bleibt.
- Du interpretierst Widerstand als „fehlende Motivation“, obwohl dahinter Angst, Überforderung oder fehlende Klarheit steckt.
3. Sie verschärft deinen inneren Leistungsdruck
Die Story vom Kampf zwischen Emotion und Vernunft klingt nach Heroismus. Du bist die Person, die trotz Müdigkeit, Trotzphase und Konflikten „professionell“ bleibt.
In der Praxis sieht das häufig so aus:
- Im Büro unterdrückst du Gefühle, weil du „funktionieren“ willst.
- Zuhause knallen sie dir dann umso heftiger um die Ohren.
Du kennst vielleicht diesen Ablauf: Morgens im Büro zusammengerissen, in einem Meeting nach dem anderen moderiert, Mittag durchgearbeitet, dann noch schnell zum Elternabend, zuhause eskaliert der Abend beim Zähneputzen. Und du fragst dich später: „Warum bin ich so ausgerastet, das bin ich doch gar nicht.“
Die klassische Sicht bietet dir darauf eine einfache, aber ungenaue Antwort: „Die Emotionen waren zu stark.“ Die neuere Forschung sagt eher: Dein System war längst am Limit, dein Gehirn hat auf Basis von Müdigkeit, Kontext und gelernten Mustern eine „Wut Version“ konstruiert, die sich automatisch anfühlte.
Was die Wissenschaft gesucht und nicht gefunden hat
Spannend wird es, wenn wir uns anschauen, was die Forschung über Jahrzehnte versucht hat, zu beweisen.
Man hat weltweit nach genau diesen emotionalen Fingerabdrücken gesucht:
- Ein Wut-Muster im Gesicht
- Ein Angst-Muster im Körper
- Ein Trauer-Muster im Gehirn
Die Idee war: Wenn Emotionen angeborene Programme sind, dann müssen sie sich irgendwo sauber messen lassen.
Das Überraschende: Trotz hunderter Studien fand man keine eindeutigen, stabilen Muster, die zu einer bestimmten Emotion gehören, etwa „die“ Herzkurve der Angst oder „das“ typische Wutgesicht. Man fand Vielfalt. Menschen sind in ihren emotionalen Ausdrücken und Körperreaktionen deutlich bunter, als die klassische Theorie erlaubt.
Für deinen Führungs- und Familienalltag bedeutet das:
- Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du an einem Gesicht zuverlässig erkennst, was jemand fühlt.
- Deine eigene „Wut“ fühlt sich an einem Tag vielleicht wie Energie an, an einem anderen wie Erschöpfung.
- Der gleiche Herzklopfmoment kann sich einmal als Angst und einmal als Vorfreude anfühlen, je nach Kontext.
Die klassische Theorie hat also jahrelang eine Art „Emotionslandkarte“ gesucht: eine feste Karte, auf der klar eingezeichnet ist, wo welche Emotion wohnt. Gefunden hat die Forschung eher ein lebendiges Straßengewirr, das sich im Alltag ständig neu organisiert.
Was heißt das nun für dich als junge Führungskraft mit Familie?
Wenn Emotionen nicht einfach fertige Programme sind, die in dir ablaufen, sondern sehr viel variabler, wird eine Sache klar: Du bist ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Aber du kannst sie auch nicht mehr so einfach auf „die anderen“ oder „die Situation“ schieben.
Konkret heißt das zum Beispiel:
- In Konflikten im Team: Statt innerlich „Der macht mich fertig“ zu denken, kannst du neugierig werden, welche Mischung aus Müdigkeit, Stress, Erwartungen und bisheriger Erfahrung dein Gefühl gerade färbt.
- Im Familienchaos am Abend: Wenn du merkst, dass du gleich laut wirst, kannst du das nicht nur als „Ich bin eben so“ verbuchen. Du kannst erkennen, dass dein System seit Stunden im roten Bereich läuft.
- In deiner Selbstführung: Du darfst aufhören, gegen deine Gefühle anzukämpfen, als wären sie ein wildes Tier. Stattdessen kannst du beginnen, sie als Signale zu lesen, die dein Gehirn auf Basis deines Körperzustands und deiner Geschichte erzeugt.
Noch bleiben wir in diesem Beitrag beim „alten Modell“, weil es so mächtig ist. Im nächsten Teil der Serie steigen wir tiefer ein in die neue Sicht der Forscherin Lisa Feldman Barrett. Dann schauen wir uns an, wie Emotionen tatsächlich konstruiert werden und welche konkreten Stellschrauben du im Führungsalltag und zuhause nutzen kannst.
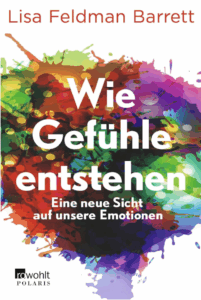
Neurowissenschaftlerin Lisa Feldman Barrett erklärt, wie Emotionen im Gehirn konstruiert werden.
Ausblick auf Teil 3 der Serie
Im nächsten Beitrag geht es darum, wie du mit dem neuen Verständnis einen echten Unterschied machen kannst:
- Wie dein Gehirn aus Körperzuständen, Kontext und Erfahrungen Gefühle baut.
- Wie du diesen Prozess im Alltag beeinflussen kannst, ohne dich zu verbiegen.
- Welche einfachen Rituale dir helfen, weniger getriggert zu sein, im Team wie am Küchentisch.
Wenn du magst, nimm dir bis dahin eine kleine Beobachtungsaufgabe mit:
Achte in den nächsten Tagen auf Situationen, in denen du denkst „Der hat mich wütend gemacht“ oder „Die Situation hat mich überfordert“. Und schau neugierig, welche Rolle Schlaf, Essen, Termindruck und deine Gedanken dabei spielen. Du musst noch nichts verändern, nur wahrnehmen. Der Rest kommt später 😊
